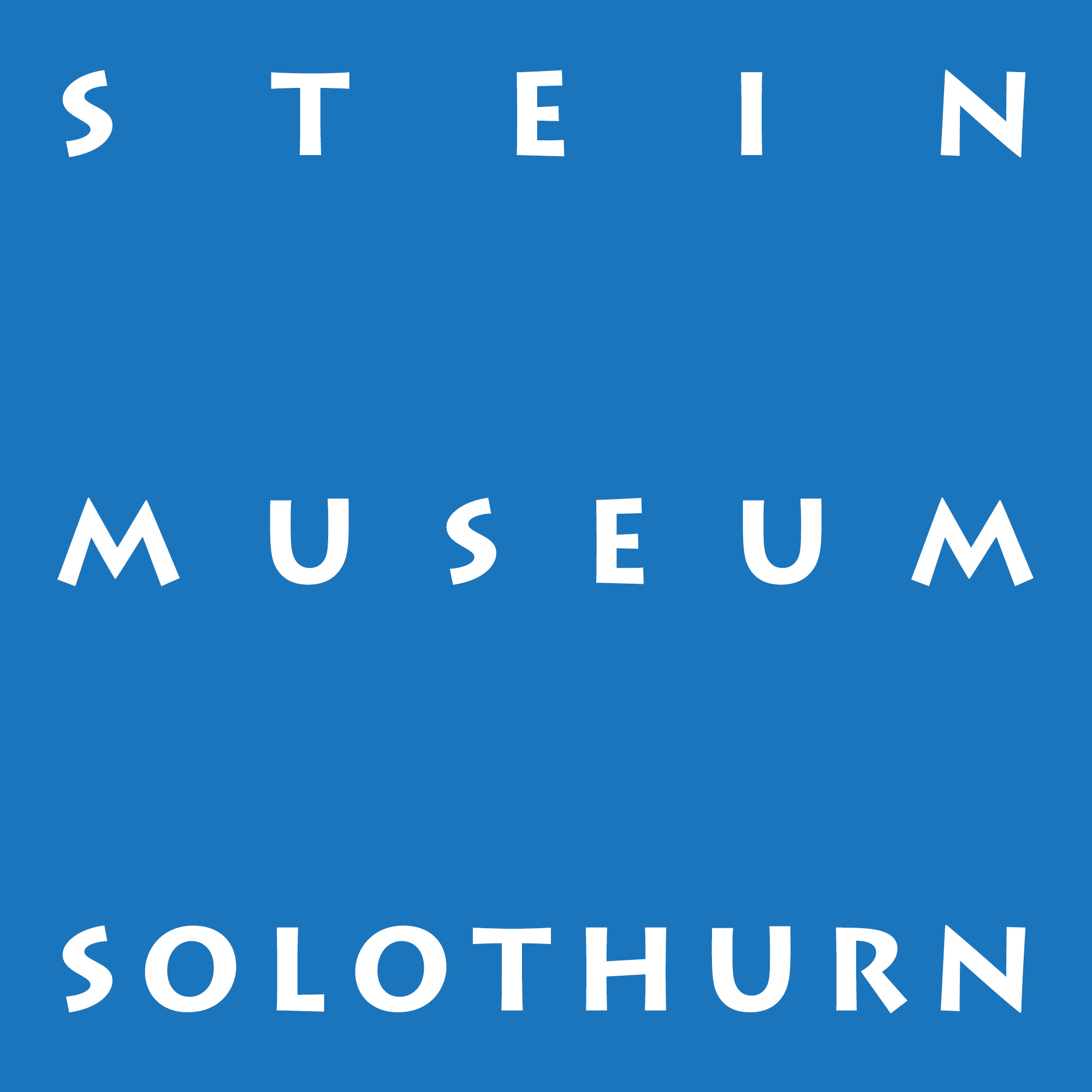Entstanden ist der Solothurner Kalkstein vor rund 150 Millionen Jahren. Hier, wo damals ein flaches Meer in ein tieferes Becken überging, lagerten sich kalkhaltige Fossile und andere Sedimente ab. Sie wurden während Millionen von Jahren unter Druck immer kompakter und verfestigten sich zu Kalkstein. Solothurner Kalkstein. Dieser ist weiss, was der Stadt ihren typischen Charakter gibt.

Johann Friedrich Dietler (1804-1874), Der Bargetzi-Steinbruch bei Solothurn, nicht datiert, Privatbesitz.
Das Gemälde zeigt den Bargetzi-Steinbruch, einen der zahlreichen Steinbrüche, die in und um Solothurn existiert haben. Ob es genau 11 sind, in denen im Lauf der Zeit Stein abgebaut wurde, ist nicht belegt. Sicher aber ist, dass bereits die Römer wussten, wie gut sich der Solothurner Stein für Bauwerke und vieles andere nutzen lässt. Ab dem 17. Jahrhundert kam es durch den Schanzenbau und später durch den Neubau der St. Ursen-Kirche zu einem regen Aufschwung. Im 19. Jahrhundert hatte sich die Steinindustrie zu einem wichtigen Wirtschaftszweig für Solothurn entwickelt und Solothurner Stein wurde bis ins Elsass exportiert. Heute wird kein Solothurner Kalkstein mehr abgebaut. Zurück bleiben die Steinbauten in und um die Stadt sowie Bauteile, Skulpturen oder Grabmale, wie sie im → Steinmuseum zu sehen sind.
Literaturtipps
Zum Solothurner Stein und dessen Verwendung
- «Solothurner Kalkstein». → www.materialarchiv.ch
- «Die Stadt Solothurn II. Kunstdenkmäler des Kantons Solothurn, Band II», Stefan Blank und Markus Hochstrasser, 2008. → KdS-online
- «Naturstein. Der Naturstein im Solothurnischen Bauwesen», Stefan Blank, 2018. → domusantiqua.ch
Zum Naturstein und zum Bauen damit
- «Werkstein», Stefan M. Holzer, 2021. → ethz.ch
- «Vom Bruchstein zum Werkstein», Stefan M. Holzer, 2021. → ethz.ch
- «Als die Kathedralen in den Himmel wuchsen. Bauen im Mittelalter», Günther Binding, 2006.
- «Stein und Steinwerk», Ernst Reinhard, 1945.
Zu spezifischen Themen rund um Solothurn und die Steinindustrie
- «Neue Erkenntnisse zum Solothurner Baseltor», Stefan Blank, 2024. → so.ch
- «Restauriert und neu betrachtet: die Ostfassade des Solothurner Rathauses», Stefan Blank, 2021. → so.ch
- «Stadtgeschichte Solothurn 19. und 20. Jahrhundert», Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn, 2020. → stadt-solothurn.ch
- «Rüttenen. Ein Platz an der Sonne», Einwohner- und Bürgergemeinde Rüttenen, 2003.
- «Eine kurze Geschichte des Solothurner Steinmuseums», Dieter Bedenig, 2015. → steinmuseum.ch
- «Die Stadt Solothurn. Stadtanlage und Befestigung», Benno Schubiger, 1994. → Kds-online
- «Gregor Bienckher, ein Solothurner Steinmetz des frühen 17. Jahrhunderts», Markus Hochstrasser, 1989. → e-periodica.ch
- «Zur Geschichte der Gründung eines Steinmuseums in Solothurn», Kurt O. Flury, 1986. → e-periodica.ch
- «300 Jahre Solothurnische Schanzen», Hans Sigrist, 1967. → e-periodica.ch
Zu archäologischen Themen
- «Solothurn und Olten – zwei römische Kleinstädte an der Aare», Mirjam Wullschleger, 2021. → so.ch
- «Neulesung einer Weihinschrift für die Göttin Epona aus dem römischen Solothurn», Andreas Kakoschke, 2017. → so.ch
Abbildungen aus historischen Quellen
- Blick von der Steingrube Kreuzen, Johann Jakob Ulrich, zwischen 1850 und 1860. → zbsolothurn.ch
- Arbeitsschritte beim Abbau von Travertin bei Tivoli (Rom). Aus: «Castelli e ponti», Niccola Zabaglia, 1743, Tabula XIV. → uni-heidelberg.de
- Steinmetze bei der Arbeit mit Steinbeil und Meissel. Aus: «Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden», Hans Sachs, 1568, S. 181. → digital.slub-dresden.de
- Steinmetzwerkstatt um 1532. Aus: «Von der Artzney bayder Glück», Francesco Petrarca, 1532, Blatt 0130. → digitale-sammlungen.de